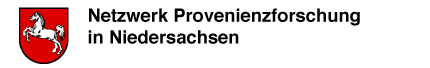Das vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste geförderte und durch das Netzwerk Provenienzforschung in Niedersachsen unterstützte Projekt startete am 1. Januar 2021 und endet am 31. Dezember desselben Jahres. Beteiligt an ihm waren das Deutsche Sielhafenmuseum Carolinensiel, die Naturforschende Gesellschaft zu Emden von 1814, das Ostfriesische Teemuseum Norden und das Fehn- und Schiffahrtsmuseum Westrhauderfehn. Den Antrag stellte und die Koordination übernahm die Museumsfachstelle der Ostfriesischen Landschaft. Ausgeführt wurden die Forschungen von Facts & Files Historisches Forschungsinstitut Berlin.
Das Projekt legte sein Augenmerk auf etwa 500 durch die beteiligten Einrichtungen benannte Objekte, von denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgingen, dass diese in einem kolonialen Zusammenhang zu Qingdao, dem ehemaligen „Schutzgebiet“ des Deutschen Reiches stehen könnten. Dies herauszufinden sowie Informationen zu den Vorbesitzerinnen und Vorbesitzern der Objekte zu eruieren, war die Hauptaufgabe des Projekts. Darüber hinaus waren auch allgemeinere Kenntnisse zu den Verhältnissen in Qingdao zur Kolonialzeit von Interesse. Als Kooperationspartner konnte Prof. Dr. Sun Lixin von der Shandong Universität in Jinan, China, gewonnen werden. Er unterstützte zusammen mit von ihm herangezogenen chinesischen Kolleginnen und Kollegen das Projekt durch Archivrecherchen in chinesischen Archiven und fachkompetente Anmerkungen zu einer Reihe der zu untersuchenden Sammlungsstücke.
Die Abschlussveranstaltung sollte vor allem die Ergebnisse der Untersuchungen vorstellen. Diese waren eingebettet in weitere Vorträge. Prof. Sun Lixin referierte zur chinesischen Gesellschaft unter deutscher Kolonialherrschaft zwischen 1897 und 1814. Prof. Cord Eberspächer vom Institut für Vergleichende chinesische und europäische Geschichte der Universität Changsha, China, richtete den Blick auf die Plünderung des kaiserlichen Palasts und auf chinesische Dinge in deutschen Museen und Sammlungen und auf ihre Herkunft. Die Kunsthistorikerin und Sinologin Stefanie Schmidt M.A. eröffnete das Thema der kolonialen Mitbringsel und fragte nach einer Massenproduktion für eine neue Käuferschaft in der Kolonie. Die Präsentation der Projektergebnisse lag dann in den Händen von Beate Schreiber und Dr. Hajo Frölich von Facts & Files.
Zu Beginn der Veranstaltung erfolgten mehrere Grußworte.
Der Präsident der Ostfriesischen Landschaft, Rico Mecklenburg, dankte vor allem den Mittelgebern, Unterstützerinnen und Unterstützern und allen, die sich aktiv am Forschungsprojekt sowie an der Durchführung der Veranstaltung beteiligt haben. Dr. Jan Hüsgen, Referent für Kultur- und Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste, stellte diese Einrichtung vor und betonte den Pilotcharakter des ostfriesischen Projekts, das vier kleinere Museen und ihre Bestände bündelt und es so ermöglicht, nicht nur große Häuser in den Metropolen in den Blick der kolonialen Provenienzforschung zu stellen. Dr. Claudia Andratschke, Koordinatorin des Netzwerks Provenienzforschung in Niedersachsen, trug ihr Grußwort auch im Namen des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur vor und bedankte sich ebenfalls bei den am Projekt mitwirkenden und das Vorhaben unterstützenden Einrichtungen und Personen. Dabei hob sie insbesondere die vier ostfriesischen Museen und deren Leiter*innen hervor, ohne deren Offenheit und Motivation, die Geschichte ihrer Häuser und die koloniale Herkunft ihrer Sammlungen aufzuarbeiten, derartige Projekte nicht möglich seien. Das Projekt sei nur der Auftakt für weitere Vorhaben in diesem Bereich, die das Netzwerk Provenienzforschung in Niedersachsen auch weiterhin gern unterstützen wird.
Prof. Dr. Sun Lixin, School of History and Culture/ German Research Centre, Shandong University
Die chinesische Gesellschaft in Qingdao unter deutscher Kolonialherrschaft (1897-1914)
Von 1897 bis 1914 nahmen die deutschen Kolonisten eine herrschende Stellung in Qingdao ein, aber die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung blieben die Chinesen.
Im Hinblick auf die Berufsklassifikation bestand die chinesische Gesellschaft Qingdaos in der Zeit der deutschen Besetzung hauptsächlich aus Arbeitern, Geschäftsleuten, Literaten, Studenten, Kompradoren (chinesischen Vermittlern in ausländischen Diensten) und Angestellten sowie ehemaligen Qing-Adligen und -Ministern.
Obwohl die deutsche Regierung der chinesischen Bevölkerung eine strikte Politik der Apartheid auferlegte, hatten die Deutschen und die Chinesen in Qingdao jedoch unweigerlich Kontakt und Austausch in verschiedenen Formen. Dazu gehörten Ausgrenzung und Widerstand, aber auch Mitwirkung und Kooperation. Durch vielfältige Kontakte erlernte und akzeptierte ein Teil der Chinesen nicht nur westliche Wissenschaft und Technologie, sondern bildete auch ein starkes Gefühl von Nationalismus aus und strebte eine unabhängige Modernisierung an. Beides spielte in der Entwicklung der Stadt Qingdao eine sehr wichtige Rolle.
The Chinese society in Qingdao under German colonial rule
From 1897 to 1914, the German colonists dominated Qingdao, but the vast majority of the population remained Chinese.According to the occupational classification, the Chinese society of Qingdao at the time of the German occupation consisted mainly of workers, business people, writers, students, compradors and employees as well as former Qing nobles and ministers.Although the German government imposed a strict policy of apartheid on the Chinese people, however the Germans and Chinese in Qingdao inevitably had contact and exchanges in various forms. These included compliance and collaboration, but exclusion and resistance as well. Through a variety of contacts, part of the Chinese not only came into contact with an began to accepted Western science and technology, but also formed a strong sense of nationalism and a desire for independent modernization. Both played a very important role in the development of the city of Qingdao.
山东大学历史文化学院/德国研究中心孙立新教授、博士
德国殖民统治下的青岛中国人社会(1897-1914)
自1897年到1914年,德国殖民者虽然在青岛处于统治地位,但当地占总人口绝大多数的依然是中国人。根据职业划分,德国占领时期的青岛中国人社会主要由工人、商人、文人、学生、买办、职员以及清朝从前的贵族和大臣组成。尽管德国政府针对中国人实行了严格的种族隔离政策,然而生活在青岛的德国人与中国人之间不可避免地存在着各种形式的接触与交流,其中包含了排斥与反抗、顺应与合作。通过接触与交流,部分中国人不仅学习并接受了西方的科学技术,更是萌生了一种强烈的民族主义感情,并且致力于谋求一种独立自主的现代化进程。他们在青岛市的发展中发挥了极为重要的作用。
Prof. Dr. Cord Eberspächer, Professor für Vergleichende chinesische und europäische Geschichte, Universität Changsha, China
Die Plünderung des kaiserlichen Palastes Chinesische Dinge in deutschen Museen und Sammlungen und ihre Herkunft
Während die Debatten um koloniale Raubkunst aus Afrika und Ozeanien und ihre Restitution in voller Intensität geführt werden, bleibt es um China merkwürdig ruhig. Dabei ist China im Verlauf der 19. und frühen 20. Jahrhunderts massiver kolonialer Gewalt ausgesetzt gewesen und hat durch Raub und Plünderung zahllose Kunstschätze verloren, die heute in europäischen, amerikanischen und japanischen Museen und Sammlungen zu finden sind. Doch China war nie eine westliche Kolonie. Da das chinesische Kaiserreich also durch die gesamte Periode des Kolonialismus ein souveräner Staat blieb, sind die Provenienzen chinesischer Kunstwerke, die in den Westen und damit auch nach Deutschland gelangten, ausgesprochen vielfältig. Sie reichen von Raubgut über Geschenke bis hin zu legalen Ankäufen und umfassen neben erlesenen Kunstwerken auch minderwertige Ware, die ausschließlich für den Export produziert wurde, von Fälschungen ganz zu schweigen.
Der Vortrag widmet sich anhand konkreter Beispiele den vielfältigen Dimensionen des Transfers von Kunstwerken und ähnlichen Gegenständen aus China nach Deutschland und trägt dazu bei, Sammlungsgegenstände und ihre Provenienz vor dem Hintergrund der deutsch-chinesischen Geschichte besser einordnen zu können.
Looting the Imperial Palace. Chinese Things in German Museums and Collections and their origin
While the debates on colonial looted art from Africa and Oceania and their restitution are engaged in full intensity, around China everything stays strangely quiet. Yet China has been object of massive colonial violence in the course of the 19th and early 20th century and lost countless art treasures through looting and pillage, that today can be found in European, American and Japanese museums and collections. But China never was a Western colony. As imperial China through the whole period of colonialism remained a sovereign state, the provenances of Chinese art objects that reached the West and Germany are remarkably manifold. They span from looted art over presents to legally purchased goods and include next to objects of art also things of minor value that were exclusively produced for export, and of course also forgeries.
The lecture will demonstrate on concrete examples the varied dimensions of the transfer of art treasures and related things from China to Germany and will thus contribute to a clearer understanding of Chinese collections and their provenances against the background of Sino-German history.
湖南师范大学中国与欧洲比较史Cord Eberspächer教授、博士
抢劫皇宫——德国博物馆与收藏中的中国物品及其来源
相较于正在热烈展开的关于从殖民时期的非洲和大洋洲所掠夺的艺术品及其归还的争论,与中国相关的这一论题却令人惊奇地鲜少讨论。然而,在19世纪和20世纪初,中国遭受了极其严重的殖民主义暴力,并在抢劫和掠夺中失去了无数的艺术珍品。如今人们可以在遍布欧洲、美国和日本的博物馆和收藏中看到这些珍品。不过,中国自始至终并未沦为西方的殖民地。由于中华帝国在整个殖民主义时期都是一个主权国家,所以到达西方——其中也包括德国——的中国艺术品的流转经历极其多样:有抢劫来的珍品,有礼物,也有合法购买的物品,其中不仅包括精致的艺术品,还有专门为出口而生产的价值不高的商品,当然还有各种赝品。本报告通过具体的事例来阐述艺术品及类似物品从中国流传到德国的多种维度,从而有助于在德中历史的背景下对这些藏品及其来源更好地进行归类。
Diskussion
Im Anschluss an die ersten beiden Vorträge war die Möglichkeit zur Diskussion gegeben. Frau Wilma Nyari, Organisatorin des „runden Tisches Kolonisierung/Dekolonisierung“ in Wilhelmshaven, forderte eine deutlich gesellschaftskritischere und nicht vorrangig historische Auseinandersetzung im Bereich Provenienzforschung ein sowie die Verwendung einer sensiblen Sprache. Ihre Aufforderung bezog sich nicht allein auf die Auseinandersetzung mit der ehemaligen Kolonie des Deutschen Reichs in China, sondern allgemein auf Situationen mit einseitiger Macht- und Gewaltausübung von Angehörigen ehemaliger Kolonialmächte in der Welt. Die Folgen der Kolonialzeit wirken bis in die Gegenwart, vor allem auf marginalisierte Gruppen, weswegen verstärkt zivilgesellschaftliche Verbände in die Projekte mit einbezogen werden sollten. In diesem Ansatz wurde sie grundsätzlich von Sina Schindler unterstützt, Projektkoordinatorin beim Verein korientation in Berlin.
Prof. Cord Eberspächer stimmte dem Anliegen prinzipiell zu. Er betonte die Prägungen und Traumatisierungen von Kolonisierten und Kolonisatoren als wichtiges Thema und dass koloniale Strukturen das Denken lange, z. T. bis in die Gegenwart bestimmen. Er gab zu bedenken, dass das Thema des Projekts konkret Sammlungsgüter mit einem kolonialen Hintergrund sei, mit einem Fokus auf China und die Betrachtung der Einzelobjekte und ihrer Geschichte erst erfolgen müsse, bevor die Debatte erweitert würde. Dr. Jan Hüsgen ergänzte den Ansatz, den das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste mit der Förderung von Provenienzen verfolgt, nämlich die Sensibilisierung für koloniale Kontexte in Museen, auch in kleineren Einrichtungen, abseits der Metropolen. Dies sowie die Kooperationen mit Vertreterinnen und Vertretern der Herkunftsgesellschaft sah er im ostfriesischen Projekt als eingelöst. Zudem wies er darauf hin, dass das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste Forschungen zu Objekten aus Gewaltkontexten prioritär bearbeitet.
Stefanie Schmidt M.A.
Koloniale Mitbringsel: japanische Massenproduktion für eine neue Käuferschaft
In vielen deutschen Sammlungen und Archiven lagern „Mitbringsel“ ehemaliger in Tsingtau/Qingdao, China stationierter (See-) Soldaten. Leider ist über diese asiatischen Kunstgegenstände, die für den jeweiligen Käufer ein Andenken an die Dienstzeit in Fernost darstellten, oft nur wenig bekannt und die Herkunftsbezeichnung mitunter irreführend. Eine kritische Betrachtung der über die Kolonie Qingdao nach Deutschland gelangten „chinesischen“ Stücke hinsichtlich der Frage nach Hersteller und Käuferschaft zeigt, dass eine Neubewertung vieler Objekte zwingend erforderlich ist.
Die Verwaltung der deutschen Kolonie in China unterstand der Leitung der Kaiserlichen Marine. Die großangelegten Bauarbeiten am Qingdaoer Hafen und die ständige militärische Besetzung des Pachtgebiets, sorgte für den regelmäßigen Zustrom einer spezifischen Gruppe Menschen – Seesoldaten. Diese wiederum stellten für den Markt eine ganz neue Art Käuferschaft dar: eine, die nur eine begrenzte Zeit blieb und individuelle Wünsche hatte. Beliebte Mitbringsel waren Porzellan, Holzschnitzarbeiten, Lack-Fotoalben, aber auch vor Ort individualisierte Seidenstickbilder.
Eine konkrete Herkunftsbestimmung ist bei Porzellanen oder Lack-, bzw. Schnitzarbeiten vergleichsweise einfach, da häufig bereits die abgebildeten Motive japanischen Ursprungs sind. Zudem sind vor allem Keramiken oft mit einer eindeutig zu identifizierenden Herstellermarke versehen. Anders sieht es bei den für Seesoldaten hergestellten Seidenstickbildern aus. Doch auch bei diesen gibt es repräsentative Stücke mit japanischen Herstellerbezeichnungen.
Es deutet alles darauf hin, dass sich japanische Händler, die zu der Zeit bereits in anderen Kolonialhäfen (darunter Shanghai und Hongkong) ansässig waren, der neuen Käuferschaft angenommen haben. Daraus ergibt sich, dass nicht jedes Mitbringsel eines Seesoldaten aus Zeiten der Kolonie Qingdao zwangsläufig einer chinesischen Herkunft zuzuordnen ist. Zweifellos wurden diese Stücke in China verkauft, jedoch von japanischen Händlern in großem Umfang (und zum Teil ausschließlich) für die oben angegebene Klientel angefertigt und vertrieben.
Colonial souvenirs: Japanese mass production for a new group of buyersMany German collections and archives store “souvenirs” from soldiers who were (sea) soldiers stationed in Tsingtau / Qingdao, China. Unfortunately, little is known about these Asian objects of art, which for the respective buyer represented a souvenir of the service in the Far East, and the designation of origin is sometimes misleading. A critical examination of the “Chinese” pieces that came to Germany via the Qingdao colony with regard to the question of manufacturers and buyers shows that a reassessment of many objects is imperative.The administration of the German colony in China was under the direction of the Imperial Navy. The large-scale construction work on Qingdao Port and the constant military occupation of the leased area ensured the regular influx of a specific group of people – marines. These in turn represented a completely new type of buyer base for the market: one who only stayed for a limited time and had individual wishes. Popular souvenirs were porcelain, wood carvings, lacquer photo albums, but also silk embroidery pictures that were customized on site.It is comparatively easy to determine the origin of porcelain or lacquer or carving, as the motifs shown are often of Japanese origin. In addition, ceramics in particular are often provided with a clearly identifiable manufacturer’s mark. The situation is different with the silk embroidery pictures made for marines. But even with these there are representative pieces with Japanese manufacturer names.Everything indicates that Japanese traders, who were already based in other colonial ports (including Shanghai and Hong Kong) at the time, have accepted the new buyers. From this it follows that not every souvenir a marine brought back from the times of the Qingdao colony can inevitably be assigned to a Chinese origin. These pieces were undoubtedly sold in China, but were made and sold by Japanese dealers on a large scale (and in some cases exclusively) for the above-mentioned clientele.
殖民地纪念品:为新顾客群批量生产的日本工艺品
许多德国收藏和档案馆中都存放有以前曾在中国青岛驻扎过的(海军)士兵带回的 “纪念品”。遗憾的是人们对这些被购买者当作是对其在远东服役时光的一种纪念的亚洲工艺品通常知之甚少,并且也时常被那些关于产地的注明所误导。出于要查清制作者和购买者而对这些经由青岛殖民地流转到德国的 “中国”物品进行的一种批判性研究表明,对许多物品重新进行评估是极为必要的。
德国在中国的殖民地由德意志帝国海军负责管理。青岛港的大规模修建工作以及对租界持续的军事占领使得“海军士兵”这样一个特定群体会定期涌入。另一方面,这些士兵又成为了市场上一个全新的购买群体:他们停留的时间有限,且有各自不同的需求。受欢迎的纪念品有瓷器、木雕、漆画相册,但也有在当地制作的具有个性色彩的丝绸刺绣画。
确定瓷器、漆画或雕刻品的具体来源相对比较容易,因为这些物品所描绘的图案通常源自日本。此外,它们往往带有一个清晰可辨的制作者的印章,特别是陶瓷制品。但为海军士兵所制作的丝绸刺绣画则不一样。然而即使在这些画中也有一些代表性作品是带有日本制作者的印章的。
各种迹象表明,当时已经在其他殖民地港口(其中包括上海和香港)经商的日本商人瞄准了这些新买家。由此可见,并不能将每一个被海军士兵从殖民时期的青岛带回来的纪念品的源头都归于中国。毋庸置疑,这些商品是在中国出售的,但它们是由日本商人为上述客户大批量制作(在某些情况下是专门制作)并经销的。
Beate Schreiber und Dr. Hajo Frölich, Facts & Files Historisches Forschungsinstitut Berlin
Provenienz China? Forschungsergebnisse des Projekts in Ostfriesland
Im Rahmen des einjährigen Projekts haben wir die Herkunft von mehr als 500 ostasiatischen Objekten in vier Museen und Kultureinrichtungen in Ostfriesland untersucht. Dabei handelte es sich zur Hälfte um Keramik, aber auch um Kunsthandwerk aus Metall, Textilien und anderes. Sofern vorhanden, wurden zuerst Provenienzmerkmale an den Objekten selbst dokumentiert. Dabei stellte sich heraus, dass viele bislang als „chinesisch“ geführte Stücke tatsächlich aus Japan stammen.
Wie in Kooperation mit Professor Sun Lixin von der Shandong University in Jinan ermittelt wurde, handelt es sich zu einem großen Teil um Export- und Massenware sowie Alltagsgegenstände. Da folglich eine Identifizierung individueller Stücke in den Quellen kaum möglich ist, wurden biografische Recherchen zu den in den Museumsunterlagen dokumentierten Vorbesitzerinnen oder Vorbesitzern genutzt, um so über die Biografien der Personen Hinweise auf einen Bezug zu China und die eventuelle Erwerbung des Objekts vor Ort zu verifizieren. Diese mehr als 60 Personen lassen sich in vier Gruppen einteilen:
- Marinesoldaten aus Ostfriesland, die in der deutschen Kolonie Jiaozhou (mit der Hauptstadt Qingdao) Dienst taten (vertreten besonders im Deutschen Sielhafenmuseum Carolinensiel)
- Zivile Beamte, Kaufleute oder Angehörige anderer Berufe in Jiaozhou (vertreten u.a. in der Naturforschenden Gesellschaft zu Emden von 1814)
- Kapitäne und Seeleute, die chinesische Häfen anliefen (bedeutsam vor allem vor 1897, vertreten u.a. im Fehn- und Schiffahrtsmuseum Westrhauderfehn)
- Antiquitäten- oder Ostasiatika-Händler in Deutschland (vertreten vor allem im Ostfriesischen Teemuseum Norden).
Aus den genannten Gründen konnten nicht alle Provenienzen geklärt werden. Konkrete Hinweise auf Raubgut konnten nicht festgestellt, aber auch nicht ausgeschlossen werden. Mit Ausnahme einiger vor 1840 ausgeführter oder nach 1949 produzierter Objekte stammen alle aus einem kolonialen Kontext – entweder aus der Kolonie Jiaozhou (das gilt wahrscheinlich auch für die erwähnten, in Japan hergestellten Objekte) oder aus einem anderen Teil Chinas, das um 1900 weitgehend durch die Kolonialmächte beeinflusst wurde. Auch diese kolonialen Erwerbungskontexte wurden untersucht. Dabei wurde deutlich, dass China kein passives Opfer des Kolonialismus war. Gerade in der Provinz Shandong, in der Jiaozhou lag, betrieb die Regierung intensive Wirtschaftsförderung und leistete den Deutschen so ökonomischen Widerstand. So entstanden zahlreiche Produktionsstätten von Kunsthandwerk, und die Zahl entsprechender chinesischer (aber auch japanischer) Geschäfte in Qingdao nahm stetig zu.
Origin China? Research results of the project in East FrisiaDuring the one-year project, the provenance of more than 500 East Asian objects in four museums and cultural institutions in East Frisia were examined. Half of these were ceramics, but also metal handicrafts, textiles, and other things. Where available, provenance markings on the objects themselves were first documented. It turned out that many of the pieces that had previously been classified as “Chinese” actually originate from Japan.With the expert support by Professor Sun Lixin from Shandong University in Jinan, it was concluded that these objects are mostly export and mass-produced goods as well as everyday objects. Since it is therefore hardly possible to identify individual items in the archival sources, biographical research on the previous owners documented in the museum files was used, and verified if these persons had any connection due to travel, work or their ancestors to the colony Qingdao. We researched more than 60 persons belonging to four types:1. Marines from East Friesland who served in the German colony of Jiaozhou (with the capital Qingdao) (particularly represented in the German Sluice Port Museum Carolinensiel)2. Civil officials, merchants, or members of other professions in Jiaozhou (represented in the Association of Naturalists in Emden from 1814)3. Captains and seamen who called at Chinese ports (most prominent before 1897, represented in the Fen and Navy Museum Westrhauderfehn, among others)4. Dealers in antiques or East Asian artifacts in Germany (mainly represented in the East Frisian Tea Museum in Norden).For the reasons discussed, full provenance information for each object could not be established. Any specific evidence of looted objects could not be determined, but that possibility can also not be excluded either. With the exception of a few objects exported before 1840 or produced after 1949, all of them derive from a colonial context – either from the Jiaozhou colony (this probably also applies to the objects mentioned, which were made in Japan) or from another part of China, which was largely affected by colonial powers around 1900.Thesecolonial acquisition contexts were also examined. Our research shows that China was not a passive victim of colonialism. Particularly in the Shandong Province, where Jiaozhou was located, the Chinese government promoted the economic development intensively, and thus created economic resistance to the Germans. This resulted in numerous handicraft production facilities, and the number of Chinese (but also Japanese) shops in Qingdao increased steadily.
柏林事实与档案历史研究所Beate Schreiber和Hajo Frölich博士
源自中国?东弗里斯兰项目研究成果
在为期一年的项目工作中,我们研究了东弗里斯兰四个博物馆与文化机构中500多件东亚物品的来源。这些物品中有一半是陶瓷,但也有使用金属、纺织品和其他材质所制作的工艺品。我们首先对手头已有的物品自身所标记的产地作了记录,结果却显示,许多之前被列为产自 “中国 “的物品实际上源自日本。
在与济南山东大学的孙立新教授合作时,我们发现这些物品主要是用于出口且批量生产的商品以及日常用品。鉴于借助档案资料几乎不可能识别单个物品,因此我们对博物馆记录中有关物品之前的所有者的生平进行了调查研究,以便通过他们的生活轨迹来验证物品与中国相关联的线索并对物品的产地予以确认。这60多名前所有者按照其身份可以分为四种类型:
- 来自东弗里斯兰的海军士兵,他们曾在德国殖民地胶州(首都青岛)服役(主要以位于德国维特蒙德市Carolinensiel城区的Sielhafenmuseum博物馆为代表)。
- 胶州的公务员、商人或从事其他职业的人员(以1814年的Naturforschende Gesellschaft zu Emden及其他组织为代表)。
- 在中国港口停靠的船长和海员(1897年前的时期极为重要,以位于Westrhauderfehn的Fehn- und Schiffahrtsmuseum博物馆为代表)。
- 生活在德国的古董商或经营东亚工艺品的商人(主要以位于Norden的东弗里斯兰茶叶博物馆为代表)。
鉴于上述各种原因,我们无法澄清所有物品的来源。我们没有发现任何掠夺财物的具体线索。然而,我们也不能排除这种可能性的存在。除了少数1840年以前出口或1949年以后生产的物品外,所有物品都带有殖民时代这一大背景——它们要么来自殖民地胶州(这可能也适用于上述在日本生产的物品),要么来自中国其他地区——中国在1900年左右几乎完全处于各殖民强权的影响之下。我们也对这一殖民时期的收购背景进行了研究。其结果显示,中国并不是殖民主义的被动受害者,尤其在胶州所处的山东省,当地政府推行了密集的经济促进措施,对德国人在经济领域进行抵抗。由此带来的是不计其数的工艺美术品生产厂得以建立,而相应的中国(但也包括日本)商店的数量在青岛也与日俱增。
Diskussion
Die Diskussion begann Frau Nyari mit einem Dank an die Referentinnen und den Referenten und der Einladung an den Runden Tisch Kolonisierung/Dekolonisierung in Wilhelmshaven. Herr Jürgens vom Pressebüro Werner Jürgens griff ein von Dr. Frölich genanntes Objekt, einen geflochtenen Zopf aus der Sammlung der Naturforschenden Gesellschaft zu Emden, auf und fragte, ob dieser nicht anders zu betrachten sei als die Mehrzahl der anderen Objekte, bei denen es sich offensichtlich um Souvenirs handele.
Frau Schreiber und Dr. Frölich stimmten hier zu und erklärten, dass bei den meisten Objekten die Quellenlage, bezüglich der Vorbesitzer und Erwerbskontexte, keine endgültigen Aussagen zuließe. Auch der geflochtene Zopf könnte als Souvenir angefertigt worden sein und müsse daher nicht unbedingt aus Menschenhaar gefertigt sein. Prof Eberspächer ergänzte, dass solche Zöpfe auch angefertigt und an chinesische Studenten oder auch Revolutionäre verkauft worden seien, die beispielsweise aus Japan oder den USA nach China zurückkehrten und ihren abgeschnittenen durch einen anheftbaren Zopf ersetzten, um der vorgeschriebenen Haartracht zu genügen. Das zweite Objekt, das Herrn Jürgens interessierte, war ein aufwändig aus Walrossbein geschnitztes Bootsmodell. Durch die Bestätigung von Frau Dr. Susanne Knödel vom Museum am Rothenbaum Kulturen und Künste der Welt in Hamburg sind aber auch diese arbeitsteilig in großen Mengen und dementsprechend ebenfalls für den Andenkenmarkt hergestellt worden, wie auch Stefanie Schmidt bestätigte.
Dr. Amir Theilhaber, Provenienzforscher für das Lippische Landesmuseum in Detmold, fragte danach, ob sich die Sammlungen mit kolonialen Kontexten in kleineren Museen der Provinz von denen der großen unterscheiden. Dr. Andratschke betonte, dass in diesen vielfach lokale Akteurinnen und Akteure eine große Rolle spielten, die aus einem Gefühl des Heimatpatriotismus heraus „ihrem“ Museum ohne das Vorhandensein von etwaiger Expertise Dinge aus den Kolonien mitgebracht hätten, weshalb deren Zuschreibung nicht immer stimmen müsse. Dr. Knödel merkte an, dass in einem großen Haus wie dem MARKK vielfach Souvenirware vorhanden sei, darüber hinaus aber auch wertvollere Objekte, bei denen naheliegend sei, dass sie nicht legal erworben wurden. Gemeinsam mit Prof. Sun wies Dr. Frölich darauf hin, dass Provenienzforschung auch in privaten Sammlungen sehr interessant und aufschlussreich sein könnte.
Rico Mecklenburg schloss die Frage nach obrigkeitlichen Reglementierungen des Handels mit Kunstwerken oder Antiquitäten, die einen kolonialen Bezug haben, an. Dr. Andratschke verwies auf das novellierte Kulturgutschutzgesetz, das die Klärung der Provenienz vor einer Ausfuhr und auch beim weiteren Handel verlangt. Ein illegaler Handel sei dadurch leider nicht ausgeschlossen. Dr. Frölich ergänzte, dass in China bereits Anfang des 20. Jahrhunderts Ausfuhrgesetze reglementierend z.B. für Objekte von archäologischen Grabungen wirkten. Hierzu habe auch Prof. Sun zahlreiche Archivquellen recherchiert.
Auf die Fragen von Frau Nyari zur Dokumentations- und Depotlage in den Museen und den Recherchen in Archiven bestätigte Frau Schreiber, dass alle der vier beteiligten Museen, bzw. Sammlungen die Objekte bereits elektronisch inventarisiert und auch fotografiert hatten. Dies habe auch die Forschungen bei zeitweilig durch die Pandemie eingeschränkten Reisemöglichkeiten sehr erleichtert. Ebenfalls sehr hilfsbereit zeigten sich die Archive, die vielfach befragt wurden. Grenzen ergaben sich hier, indem, z.B. durch Unglücksfälle, Quellenbestände vernichtet sind.
Dr. Heike Ritter-Eden vom Deutschen Sielhafenmuseum Carolinensiel bedankte sich im Namen der teilnehmenden Häuser dafür, dass dies Projekt durchgeführt werden konnte. Die neuen Erkenntnisse seien wichtig und würden in die Ausstellungen mit aufgenommen werden.
Auch Rico Mecklenburg bedankte sich bei allen Referentinnen, Referenten und Gästen und schloss die Veranstaltung.