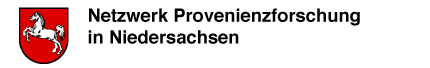Termine
Kompaktkurs "Spurensuche"

Von Montag, 13.05.2024 bis Freitag, 17.05.2024
Archivkunde für die postkoloniale Provenienzforschung vom 13.5. bis 17.5.2024 in Gießen
Liebe Provenienzforscher:innen,
„Wir unterstützen insbesondere die Rückgabe von Objekten aus kolonialem Kontext“, heißt es im Koalitionsvertrag. So möchte die Bundesregierung die „Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte“ erreichen und sogar „koloniale Kontinuitäten“ überwinden.
Sie wissen als Praktiker:innen, dass vor der Rückgabe von Objekten die mühevolle Arbeit steht, Spuren der Herkunft, der Aneignung oder des Raubs zu suchen.
Archive mit ihren Beständen aus der Kolonialzeit sind dafür eine zentrale Ressource. Mit etwas Orientierung kann es hier gelingen, Verschüttetes und Verdrängtes wieder aufzudecken. In unserem Kompaktkurs „Spurensuche“ wollen wir Zugänge zur Archivarbeit eröffnen und produktive Ansätze aufzeigen.
Auf dieser Seite finden Sie eine Beschreibung des Programms mit einem detaillierten Wochenplan. Sie können sich per Online Formular verbindlich anmelden. Wir geben Ihnen die Kontaktinformationen für Rückfragen und listen alle Beteiligten auf.
Wir würden uns freuen, Sie für den Kurs in Gießen begrüßen zu dürfen!
Bettina Brockmeyer, Larissa Förster, Jan Hüsgen und Patrick Merziger
Gedenkkolloquium für Prof. Rebekka Habermas

Von Dienstag, 23.04.2024 bis Dienstag, 02.07.2024
Die Vergangenheit
Der Gegenwart
Eine Reihe in Gedenken an die Historikerin Rebekka Habermas
23.04.24, 18–20 Uhr: BETTINA BROCKMEYER (GIEßEN)
Indifferenz und Ignoranz statt Amnesie und Aphasie.
Zum westdeutschen Umgang mit der Kolonialvergangenheit
(1945–1989)
Universität Göttingen, ZHG 001
21.05.24, 18–20 Uhr: HUBERTUS BÜSCHEL (KASSEL)
Leiden. Zur Schwierigkeit eines historischen Konzepts
Forschungskolleg Transkulturelle Studien, Pagenhaus, Gotha
04.06.24, 18–20 Uhr: HOLGER STOECKER (GÖTTINGEN)
Zur Provenienz und Restitution von Ancestral Remains aus
kolonialen Kontexten in universitären Sammlungen
Universität Göttingen, KWZ 0.610
02.07.24, 16–18 Uhr: LYNDAL ROPER (OXFORD)
Thinking across Disciplines .
Aufruhr and the German Peasants’ War 1524-6
Forschungskolleg Transkulturelle Studien, Pagenhaus, Gotha
Eine Online – Teilnahme ist möglich. Bei Interesse wenden Sie sich an:
oder
Weitere Informationen finden Sie hier.