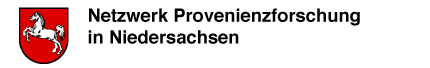Das Working Paper des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste „Locating Namibian Cultural Heritage in Museums and Universities in German-Speaking Countries. A Finding Aid for Provenance Research“ wurde am 9. April im Goethe-Institut im namibischen Windhoek vorgestellt.
Auf der Veranstaltung sprechen Dennis Schroeder (Goethe-Institut Namibia), Ndapewoshali Ndahafa Ilunga (Director of the Museums Association of Namibia), Prof. Dr. Larissa Förster (Leiterin des Fachbereichs Kultur- und Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten am Deutschen Zentrum Kulturgutverluste) und Boyson Ngondo (Acting Director of the Directorate National Heritage and Culture Programme in the Ministry of Education, Culture and the Arts).
Die Studie versammelt erstmals Informationen aus ca. 40 ausgewählten Museen und Universitäten in Deutschland, der Schweiz und Österreich zu knapp 19.000 Objekten, die zum Großteil infolge der Kolonisierung durch das Deutsche Reich in die Institutionen kamen und dort in den meisten Fällen bis heute aufbewahrt werden.
Die Publikation ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen dem Ministerium für Bildung, Kunst und Kultur in Namibia, der Museums Association of Namibia, dem National Museum of Namibia, der University of Namibia und dem Deutschen Zentrum Kulturgutverluste.
„Locating Namibian Cultural Heritage in Museums and Universities in German-Speaking Countries. A Finding Aid for Provenance Research“ wurde von Larissa Förster und Gesa Grimme (Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland) sowie Christoph Rippe (freiberuflicher Provenienzforscher) erarbeitet und ist in der Reihe „Working Paper Deutsches Zentrum Kulturgutverluste“ erschienen. Das Working Paper ist auf der Publikationsplattform der Max Weber Stiftung https://perspectivia.net kostenfrei abrufbar unter: https://doi.org/10.25360/01-2024-00002
Das Working Paper wurde Ende Februar 2024 bereits in Berlin vorgestellt.